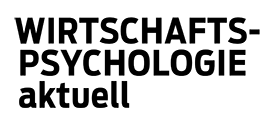Was Unternehmen von Kultureinrichtungen lernen können
Theater- und Opernhäuser gelten als Orte der Kreativität und Lebendigkeit, doch sind staatliche und kommunale Kultureinrichtungen häufig von verkrusteten Strukturen und strengen Hierarchien geprägt. Allerdings wandeln sich die Erwartungen der Mitarbeitenden und des Publikums. Coachin und Buchautorin Christina Barandun erzählt im Interview, wie sie Kulturhäuser bei der Organisationsentwicklung begleitet, wie sie Struktur in das kreative Chaos bringt und was Industriebetriebe von Kultureinrichtungen lernen können.
Frau Barandun, was verstehen Sie unter dem „Primat der Kunst“ und wie wirkt es sich auf die Arbeit in Kulturinstitutionen aus?
In der Kulturlandschaft der darstellenden Künste gibt es drei Gruppen von Betrieben: Die vorwiegend öffentlich geförderten Staats- und Stadttheater, die Privattheater und die freie Szene. In Ersteren trifft man tatsächlich noch Spuren der feudalen Vergangenheit der Hoftheater an. Die Strukturen sind streng hierarchisch auf eine künstlerische Persönlichkeit ausgerichtet, die sich nicht primär mit Führung und Management befasst, sondern mit dem künstlerischen Produkt. Diesem wird alles untergeordnet, die Bezahlung und Arbeitszeiten sind oft schlecht und das Burnout-Risiko selbst für intrinsisch hochmotivierte Kunstschaffende steigt. Außerdem nehmen die Geschwindigkeiten zu, weniger Personal muss mehr Produktionen übernehmen, es gibt kaum Puffer für krankheitsbedingte Ausfälle.
Zu lange haben die Träger:innen (Städte, Kommunen und Bund) die etablierten Strukturen gefördert. Hinzu kam die im Grundgesetz festgeschriebene Kunstfreiheit, die sich allerdings nur auf das Geschehen auf der Bühne bezieht, nicht auf die Arbeitsprozesse und -strukturen. Natürlich kann ich jemanden auf der Bühne nackt zeigen, aber der Probeprozess selbst, ebenso wie die Rahmenbedingungen für die Vorstellung, sollte höchst sensibel und schutzbietend gestaltet sein. Auch die individuellen Grenzen unter dieser psychischen Belastung sollten beachtet werden. Heutzutage funktioniert es nicht mehr, über den bösen Kapitalismus auf der Bühne zu reden, aber im Alltag Schauspieler:innen bis zur Erschöpfung proben zu lassen. Die Arbeitsproduktionsprozesse unterliegen dem Arbeitsschutzgesetz.
Ein weiteres Problem sind Konflikte im Personal durch die besondere Aufgabe eines Theaters. Ein Beispiel: Bei Vorstellungen übernimmt eine Parallelhierarchie, angeführt durch die Abenddienstleitungen und Inspizient:innen, Macht und Verantwortung – die im Alltagsgeschäft jedoch andere Personen besitzen. Da sind Konflikte vorprogrammiert: Wann ist wer mit welcher Funktion und Entscheidungsmacht unterwegs? Es funktioniert irgendwie, doch ohne die transparente Klarheit, die die junge Generation zunehmend fordert. Passende Strukturen und Konzepte fehlen.
Es braucht folglich einen Wandel.
Genau. Zum einen verändert sich die Gesellschaft und mit ihr das Publikum. Kulturhäuser benötigen daher flexiblere Produktionsprozesse, um z. B. auch Menschen mit anderen Denk- und Sehgewohnheiten aufgrund des Alters, des kulturellen Hintergrunds, der Bildung etc. anzusprechen. Zum anderen wandelt sich der Arbeitsmarkt. Viele Stellen in Kultureinrichtungen sind nicht besetzt, weswegen Theaterhäuser überlegen müssen, wie sie wieder attraktiv für Arbeitnehmende werden.
Erste Veränderungen werden seit einigen Jahren sichtbar: Es gibt Teamleitungen, Frauen übernehmen häufiger Intendanzen und die junge Generation möchte Familien gründen – neben der Kunst. Organisationsentwicklung in Kultureinrichtungen ist folglich ein hochaktuelles Thema.
Wie können Kultureinrichtungen den Wandel gestalten?
Der erste Schritt ist ein Umdenken: Viele Häuser fangen an, Organisationsentwicklung nicht mehr als Tabu anzusehen, und legen ihre Skepsis gegenüber allem, was nach Wirtschaft und Kapitalismus klingt, ab. In den letzten fünf Jahren haben sich Netzwerke, Vertreter:innengruppen und Interessenverbände gegründet. Für einen allumfassenden Austausch habe ich vor drei Jahren mit zwei anderen „Zukunft des Theaters“ ins Leben gerufen: Ein Format für einen sparten-, hierarchie- und formübergreifenden Austausch ohne konkreten Auftrag und Ziel. Man ist miteinander im gleichen Raum, hört aufeinander, lernt Perspektiven kennen, entwickelt Ideen. Es gab bereits zwei Veranstaltungen und wir wollen das Format fortsetzen, weil es explizit alle Interessierten, auch jenseits des Theaters, einlädt, gemeinsam eine Vision zu entwickeln.
Ein anderes Beispiel ist der Wechsel von Intendanzen. Derzeit begleite ich einen solchen Transformationsprozess. Noch bevor die Intendanz übergeben wird, haben wir uns mit zwei Workshops in der „neuen“ Leitungsrunde kennengelernt, ein gemeinsames Verständnis für die Zukunft entwickelt und v. a. grundsätzliche Kommunikationsstrukturen besprochen, damit der Übergang weicher wird. Es gilt, den Wandel nicht zu unterbinden, sondern auf der Welle des Wandels surfen zu lernen.
Sie sprechen auch von einer „Evolution von unten“. Wie funktioniert diese?
Indem man lernt und lernend bleibt. Zentral sind dafür die Räume des Miteinanderredens. Beispiele können Begegnungstage sein, an denen alle Mitarbeitenden miteinander ins Gespräch kommen und Fragen und Ideen sammeln. Entscheidend ist die Steuerungsgruppe aus Mitarbeitenden, die selbst diese Tage in den Kleingruppen moderieren. Es entsteht ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter Kolleg:innen und aus diesem eine Entwicklung von innen heraus. Das Aktivierungsniveau steigt, man kommt aus der Opferrolle raus und es entsteht Selbstwirksamkeit, weil man nicht mehr bloß die Vorgesetzten für Missstände verantwortlich macht, sondern Transformationsgruppen und AGs bildet. Durch das Format selbst kann ein „Unbossing“ stattfinden, da es den Führungskräften einen idealen Rahmen bietet, um zuzuhören und zu verstehen, was gerade los ist.
Ein Haus muss spüren, dass es miteinander gestalten kann. In Theaterhäusern kennt man meist gar nicht alle Berufsgruppen. In einem Workshop fragte z. B. ein Schreiner eine Dramaturgin: Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Die Durchmischung der Berufssparten in Kultureinrichtungen ist enorm und reicht von hochphilosophischen zu pragmatisch technischen zu quasi ausgestorbenen Gewerken.

Im Gespräch mit Christina Barandun (Foto: PicturePeople Fotostudio Bonn)
Dieses Reden miteinander erfordert das Aufbrechen von Hierarchien. Stoßen Sie auf Widerstand?
Reden miteinander muss nicht heißen, dass Hierarchien aufgebrochen werden. Außerdem ist der Teamgedanke im Kunstkontext sehr geläufig. Die Regie kann nicht ohne Gruppen arbeiten, sonst käme kein Stück auf die Bühne. Was fehlt, ist das Know-how zu Führungsthemen und Tools. Auch gibt es Missverständnisse zwischen den Generationen: Junge Leute wünschen sich Klarheit und Teilhabe, aber verstehen darunter nicht, mitzuführen und Verantwortung zu übernehmen, sondern gehört zu werden und das Ausmaß ihrer Aufgaben zu verstehen. Um Bedürfnisse richtig einzuordnen, ist daher Austausch unabdinglich.
Hilfreich sind regelmäßige Retrospektiven, in denen man kurz innehält und Bilanz zieht. Was haben wir geschafft, was hätte anders laufen sollen? Erfolge und Leistungen wahrzunehmen gibt Motivation und zeigt Ressourcen und Potentiale auf. Zudem erkennt man, an welchen Punkten man nachjustieren muss. Wir brauchen lernende Systeme, in denen man den hinderlichen Stein, um den alle immer herumlaufen (z. B. veraltete IT), einmal mit etwas Kraft ganz aus dem Weg räumt. Auch wenn angeblich die Zeit dafür fehlt, sind am Ende doch alle froh, dass sie Zeit investiert und grundlegende Dinge geklärt haben.
Welche Arbeitsbedingungen fördern Kreativität und Effektivität in der Kulturbranche?
Tatsächlich haben Kulturbetriebe gegenüber anderen Wirtschaftsbetrieben in Sachen agiles Mindset und Kreativformate die Nase vorn. Stelle ich einem Schauspielensemble eine Frage, würde die Gruppe ohne Lenkung stundenlang diskutieren, so immens ist der Wust an Kreativität. Sie brauchen keine Spielchen und Eisbrecher, das ist für sie Alltag. Gefragt sind vielmehr Struktur, Halt und Grenzen, ohne den Kreativraum zu blockieren.
Es ist wie ein feines Weben von Energien. Künstler:innen sind hochsensibel und kommen aus ihrem Fluss raus, wenn ich ihnen zu viel Impuls, Druck oder Klarheit gebe. Deswegen bin ich sehr achtsam, um – daher der Titel meines aktuellen Buchs – einen sicheren Raum zu bieten, in dem alle in ihrer Empfindsamkeit geschützt sind. Künstler:innennaturen sind anders gestrickt, weil die Themen der Bühnenstücke oft persönlich und mit der eigenen Biografie verbunden sind. Hinzu kommen Hochsensibilität und Hochbegabung. Es wird oft geweint, weil Emotionen ihr tägliches Handwerk sind – ihre Sprache, wenn man so will – und die nach außen gelebte Dramatik in Kultureinrichtungen schlichtweg höher ist als in anderen Gruppen. Das heißt für mich, das Drama-Niveau einzuordnen und manchmal die Regler runterfahren.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit in Kulturbetrieben?
Ehrlich gesagt funktioniere ich in Wirtschaftsbetrieben gar nicht. Umgekehrt kommen manche meiner Kolleg:innen aus der Wirtschaft mit meinen Kund:innen nicht klar, weil man meist die eigene Agenda nicht 1:1 umsetzen kann. Im Theater halten sich die Teilnehmenden nicht immer an Ansagen, dort wird gerne erstmal alles grundsätzlich hinterfragt. Als Coachin versuche ich den Flow der Gruppe nicht zu eng zu steuern, sondern mit ihm mitzugehen und immer mal wieder einen lenkenden Impuls zu setzen. Ich fühle mich wohl im Kulturkontext, weil es dort die Kreativität und Assoziativität bereits gibt, die woanders erst mit Übungen erzeugt werden müssen. Auch kenne ich durch mein Studium der Theaterwissenschaften die Branche.
Welche Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit lassen sich auf andere Wirtschaftsbereiche übertragen?
Meine Vision wäre, dass Industrie- und Kulturbetriebe beieinander hospitieren, da sie viel voneinander lernen könnten. Angestellte von Kultureinrichtungen würden strukturierte Arbeitsprozesse kennenlernen und eine andere Ruhe und Gelassenheit mit der Arbeit. Andersherum könnten Industriebetriebe von der Schnelligkeit und Leichtigkeit des Miteinanderspielens der Theaterhäuser viel mitnehmen und sich beflügeln lassen von diesem Gefühl, dass bei einer Vorstellung alle gemeinsam mitwirken. Beim Entstehen des Produktes und dann bei der Vorstellung alle miteinander zu spüren, empfinde ich als etwas ganz Besonderes in Kulturbetrieben.
Vielen Dank für das Gespräch!
Wir sprachen mit:
Christina Barandun hat Wirtschafts- und Theaterwissenschaften studiert, Coaching- und Organisationsentwicklungsweiterbildungen durchlaufen und arbeitet als systemische Beraterin, Trainerin und Coachin mit Kulturbetrieben. Als Buchautorin widmet sie sich der Konfliktlösung, Organisationsentwicklung und Kommunikation in Kulturbetrieben.
Zum Weiterlesen:
[Werbung] Barandun, C. (2023). Dynamic Safe Spaces. Der geschützte Raum. Erfolgreiche Kommunikation in künstlerischen Ensembles und Kulturbetrieben. BERLIN: Alexander.
---
Ihnen hat der Beitrag gefallen und Sie möchten keinen weiteren verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn!